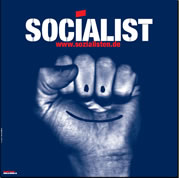Beschlossener Leitantrag der Jahreshauptversammlung der sozialistischen Jugend [’solid] in Baden-Württemberg am 7. und 8.Februar in Freiburg

Intro
Die Jugendzeit wird in dieser Gesellschaft immer weniger als wichtige Entwicklungsphase zur Herausbildung einer eigenständigen und selbstdenkenden Persönlichkeit gesehen - dementsprechend schlecht und kastriert zeigen sich auch die von der Gesellschaft der Erwachsenen gewährten Freiräume für Jugendliche sich zu entfalten.
Die Jugendzeit wird vielmehr als kurzer Duchlauferhitzer gesehen auf dem Weg zum Erwachsen werden und soll mit Lernen, der Vollziehung von Anpassungs- und Ausleseprozessen und ähnlichem verbracht werden, so dass ein möglichst reibungsloser Übergang in die Arbeitswelt gewährleistet wird. Eine solche Sicht reduziert den Menschen zur Ware bzw. zum Werkzeug der Produktionsprozesse und lässt für individuelle Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung kaum noch Raum.
In der alltäglichen Konsequenz bedeutet dies, dass Jugendliche daran gehindert werden die Welt frei zu entdecken, in ihr und an ihr zu lernen und überall auf Grenzen stoßen die sie zwanghaft in die Kategorien der Produktions- und Profitgesellschaft pressen wollen. Das Auslebung eines eigenen, oft alternativen Lebensentwurfes ist kaum möglich. Dahinter stehen auch überkommene Vorstellungen von Erziehung, die geringe Akzeptanz tatsächlicher jugendlicher Selbstständigkeit und letztendlich mangelndes Vertrauen.
In der Schule stehen so z.B. Konformität und Leistungsdruck mit dem Ziel der Auslese vor individueller Förderung, Stärkung der persönlichen Fähigkeiten und der bewussten Schaffung von Freiräumen die mit eigenen Ideen und Werten gefüllt werden können. Selbstverwaltete oder autonome Jugendzentren werden argwöhnisch beobachtet und oft finanziell unter Druck gesetzt oder ganz geschlossen, da sie außerhalb der Kontrolle der Erwachsenen-Gesellschaft existieren. Die "demokratischen" Mitbestimmungsmöglichkeiten für Jugendliche beschränken sich zum größten Teil auf Wählen ab dem 18. Lebensjahr oder teilweise auf die Bildung finanziell streng budgetierten Jugendgemeinderäten ohne wirkliche Mitentscheidungsrechte.
Diese Gesellschaft wird der Bedeutung und Wichtigkeit der Jugend für die Herausbildung aktiver, kritischer und frei denkender Individuen nicht gerecht - sie will es so wohl auch nicht!
I. Demokratie. Wählen. Jugendgemeinderat.
Aktives Wahlrecht ab 16!
Das aktive Wahlrecht ist ein Grundrecht und ein Mittel der Mit- und Selbstbestimmung. Nur wer wählen darf, kann heute aktiv teilhaben und seine Interessen aktiv vertreten! Heute erleben Jugendliche zu oft, dass über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen werden. Bisher sind Jugendliche von den Entscheidungen der Kommunalpolitik unmittelbar und direkt betroffen, ohne dass sie daran mitwirken können.
Aber junge Menschen wollen ernst genommen werden und Stück für Stück Verantwortung übernehmen. Sie sind nicht so unpolitisch wie sie allgemein beschrieben werden. Wissenschaftliche Untersuchungen beweisen zu dem, dass Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres politisch entscheidungsfähig sind und dem Abschluss der Pflichtschulzeit die Bereitschaft und die politische Kompetenz für die Teilnahme an Wahlen in Form der Wahrnehmung des aktiven Wahlrechts besitzen. Sie wollen sich verwirklichen, haben ganz konkrete Ziele und Wünsche.
Die Einführung des Jugendwahlrechts ab 16 wäre ein wichtiges Signal an die junge Generation. Jugendliche könnten so stärker in lebenswichtige politische Zukunftsentscheidungen integriert und ihre Meinung miteinbezogen werden. Sie würden sich ernst genommen fühlen und würden diesen Respekt an die Gesellschaft zurückgeben können und sie bereichern.
Parteien wären so gezwungen, sich stärker mit Themen aus einander zusetzen, die Jugendliche besonders bewegen; Themen wie Jugendarbeit, Kultur, Bildung, die Schaffung von Ausbildungsplätzen, Freizeit, Drogenpolitik oder die Armutsvermeidung und –bekämpfung, Umweltschutz und anderes mehr würden ein weitaus größeres Gewicht bekommen.
Die Absenkung des Wahlalters ist eine Chance, junge Leute frühzeitig an demokratische, parlamentarische Strukturen heranzuführen und damit Demokratie erleb- und erlernbar zu machen. Auch die Schule ist in diesem Zusammenhang verpflichtet, uns Jugendliche an die politische Öffentlichkeit heranzuführen. Geschichtliche Grundlagen, politische Aktualität müssen Jugendlichen erklärt werden, um politisches Interesse für ihr Umfeld zu wecken. Die Menschen heute treten viel früher ins Jugendalter ein und verlassen es später. Durch mangelnde Arbeitsplätze verlängert sich die Schul- und Ausbildungszeit.
Es herrscht eine deutliche Diskrepanz von sozialer und juristischer Reife. Dieser Entwicklung wird erst durch die Einführung des Jugendwahlrechts Rechnung getragen. Denn wir sind diejenigen, die künftig mit den heute getroffenen Entscheidungen leben müssen. Eine Änderung des Wahlrechts sollte mit einer Informationspflicht der Altersgruppe einhergehen.
Langfristig kann sich daran die Überlegung anschließen, das Wahlalter schrittweise auch auf 14 zu senken. Dies muss allerdings mit einer entsprechenden Würdigung von gesellschaftspolitischen Themen in der Schule und der Gesamtgesellschaft einhergehen. Erst wenn Jugendliche schon früh für solche Themen sensibilisiert sind und die Folgen ihrer politischen Entscheidungen abschätzen können.
Jugendgemeinderäte
Die Schaffung von gut-ausgestatteten Jugendgemeinderäten mit wirklichen Mitbestimmungsrechten ist ein weiterer Schritt zu einer Demokratisierung der Gesellschaft und der Jugendstrukturen. Dadurch würden Jugendliche nicht nur frühzeitig den Dialog miteinander suchen und ihre Wünsche und Ideen besser in der kommunalen Alltagspolitik besser vertreten sehen, die Einbeziehung von Jugendlichen in den politischen Prozess würde auch zu einer positiven Verbreiterung der kommunalen Agenda führen.
Bei den derzeit existierenden Jugendgemeinderäten in Baden-Württemberg besteht zumeist jedoch das Problem, dass sie über keine wirklichen Mitbestimmungsmöglichkeiten verfügen und ihr Budget stark begrenzt ist. In der Öffentlichkeit werden sie deshalb kaum wahrgenommen, die Wahlbeteiligung liegt zumeist unter 25% und ihre Arbeit beschränkt sich in manchen Städten nur auf die Organisation von Partys und Jugendfesten. Um diesem Problem zu entgegnen, müssen die Jugendgemeinderäte mit wirklichen Entscheidungsmöglichkeiten ausgestattet und mit in die Verantwortung gezogen werden, um die Jugendlichen stärker zu politisieren und für politische Probleme zu sensibilisieren.
Wir fordern auf der anderen Seite die Jugendgemeinderäte auf, ihre organisatorischen Strukturen zu überprüfen und ihre Arbeit transparenter machen. Sie dürfen nicht als Kindergartenparlamente fungieren, sondern müssen eigenständig eine kritisch-integrative Arbeit betreiben.
II. Bildung ist Zukunft!
Schule oder Schule?
Schule hat heutzutage für junge Menschen keinen emanzipatorischen Anspruch! Jugendliche können sich derzeit in der Schule nicht selbst verwirklichen und werden auch nicht in ihren persönlichen Stärken gefördert. Vielmehr bedeutet Schule für die SchülerInnen zumeist Auswendiglernen, vollgestopfte Stunden- und Lehrpläne, harte Selektionsprozesse und nicht selten unmotivierte Lehrer.
Durch die Oberstufenreform der Landesregierung wurde diese Situation noch verschärft: Lehrer und Schüler sind vollkommen überfordert, an vielen Schule betreiben die Lehrer nur noch „Dienst nach Vorschrift“, Klassenfahrten und Projekttage sind gestrichen, die Anzahl der „gefährdeten“ Schülerinnen und Schülern ist seit Einsetzen der Reform in die Höhe geschnellt. Durch den Wegfall der meisten Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe haben die Jugendlichen kaum noch Möglichkeiten, ihren Lehrplan nach ihren Vorstellungen zusammenzustellen, sondern müssen sich auch hier der Verwertungslogik unterwerfen. Die anschließende Motivation tendiert gegen Null.
Wir wollen eine Schule, deren Augenmerk sich auf die menschlichen Bedürfnisse der SchülerInnen und auch der LehrerInnen richtet! Dazu bedarf es aber einer Abschaffung des Frontal- und Paukunterrichts und ein Ende des selektiven Leistungsprinzips. Stattdessen müssen die Fähigkeiten der Schüler individuell und kritisch begleitet und gefördert werden, um Fehler zu verbessern und Schwächen durch deren Anerkennung zu beseitigen. Statt gefördertem Konkurrenzdenken und der frühzeitigen Auslese muss die natürliche Neugier der Kinder gefördert und erhalten werden, damit Schule wieder Spaß macht!
Dazu muss die integrierte Gesamtschule zur Regelschule und die Klassen wieder kleiner werden - denn unsere Schulen stellen einen wichtigen Ort in der Prägung von Persönlichkeit und Charakter dar. Auch deswegen gehören soziale Ausgrenzungen und Ungerechtigkeiten nicht in die Schulen. Schule muss zu einem sozialem Lebensraum werden! Dazu gehören gelebte Solidarität, Kultur, Politik, Integration und Spaß - erreichbar u.a. durch Ganztagsschulen mit Spielezimmern, Sportanlagen, unzensierten Schülerzeitungen, vielseitigen Projekten & Ags, Mensen, etc. All diese Dinge fehlen im heutigen Schulsystem und führen zu überforderten Lehrern, dem Konsum von Aufputschmitteln, um dem Leistungsdruck standzuhalten und zu Ausbrüchen von Gewalt. Eindeutige Indizien dafür sind u.a. auch der kontinuierliche Anstieg bei Nachhilfestunden und die steigende Zahl an Schülern und Lehrern die sozial-psychologische Betreuung in Anspruch nehmen.
Schule aus – Ausbildung macht Schule!
Die Einschränkung der Arbeitnehmerrechte und der Stellenabbau vor allem bei größeren Unternehmen in Zeiten einer neoliberalen Globalisierung bleibt auch für Jugendliche nicht ohne Folgen: immer mehr junge Menschen finden nach der Schule keinen Ausbildungsplatz und sind arbeitslos. In den letzten Jahren hat sich diese Situation durch die Wirtschaftskrise weiter verschärft. Um langfristig genügend Arbeitsplätze zu sichern und einen drohenden Fachkräftemangel zu vermeiden, ist es notwendig, die Kosten der Ausbildung gerechter zu verteilen. Eine gesetzliche Regelung könnte hierbei Ausbildungsplätze erhalten, sowie das Angebot an betrieblichen Ausbildungsstellen erhöhen.
Deshalb fordern wir, die sozialistische Jugend ['solid] in Baden-Württemberg eine solidarische Ausbildungsumlagefinanzierung! Hierfür würden alle Unternehmen, Betriebe und Verwaltungen Abgaben in einen Ausbildungsfond zahlen, wobei für die Höhe der Abgabe Kriterien wie die Zahl der Beschäftigten, Lohnsumme und die Wertschöpfung des Unternehmens ausschlaggebend ist. Betriebe, die anschließend Ausbildungsplätze stellen, erhalten wiederum eine ausgleichende Unterstützung aus dem Ausbildungsfond für die Beibehaltung und weitere Entstehung von Ausbildungsplätzen. Dadurch könnten nun auch Betriebe, die es sich bisher nicht leisten konnten auszubilden, durch ihren Anspruch auf einen Anteil am Fond Ausbildungsplätze schaffen.
Um diese Forderung durchzusetzen oder für die Erhaltung und Erweiterung der Arbeitnehmerrechte erfolgreich zu kämpfen, muss die Position der Gewerkschaften – auch von Jugendlichen - gestärkt werden. Ein Engagement in einer Gewerkschaft ist sicherlich kein sinnloses unterfangen, sondern notwendig, um soziale Gerechtigkeit zu erstreiten.
III. Unser Leben gehört nicht den Konzernen - Freiräume schaffen und verteidigen!
In vielen Städten, aber noch viel stärker auf dem Land fehlt es an Möglichkeiten für unabhängige und außerhalb von Verbänden organisierte Jugendkultur, in welcher Jugendliche sich frei nach ihren Interessen entfalten und entwickeln können. Selbstverwaltete Jugendzentren werden zumeist finanziell und bürokratisch unter Druck gesetzt oder – wie in Heidelberg - gleich abgerissen. Auch städtische Jugendarbeit findet, wenn überhaupt, nur in begrenztem Rahmen und wenig effizient statt. Es mangelt fast überall an Personal und den entsprechenden Räumlichkeiten, um ein Zentrum für eine große, integrative Jugend- und auch Gegenkultur zu schaffen. Verbunden mit Perspektivlosigkeit zeigen sich die Folgen von diesen Versäumnissen vor allem in dem weiteren Wachsen rechter und rechtsextremistischer Strukturen, bzw. der informellen Rechtslastigkeit und rassistischen Ressentiments bei Jugendlichen zumeist auf dem Land.
Auf der anderen Seite werden viele Organisationen der Berufsjugendlichen finanziell stark gefördert und vorhanden Mittel erreichen so nur einen Teil der Jugendlichen. Jugendkultur außerhalb von Vereinen hat kaum eine Möglichkeit in den Genuss kommunaler und staatlicher Gelder zu kommen. So ist z.B. der so genannte Ring Politischer Jugend im Grunde eine Finanzgremium der Jugendverbände der Großen Parteien. Viele politische Jugendliche wie örtliche Gruppen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, Antifas, Subkultur-Vereine sind von diesen Mitteln ausgeschlossen, obwohl sie wertvolle und Eigenverantwortung stärkende politische Arbeit leisten. Selbiges gilt auch für Sportinteressierte außerhalb der Vereine und Sportverbände, wie Inline-Skater, Biker, Skater und BmXer, die sich ihre Sportplätze meist illegal erobern müssen und früher oder später wieder verjagt werden.
['solid] setzt sich ein für Freiräume und Räume für selbstorganisierte und freie Jugendarbeit fern von der Trägerschaft durch Kirchen und Verbände. Wir setzen uns ein für Möglichkeiten selbst Erfahrungen zu sammeln und Kultur und Zusammenleben so zu gestalten wie es die Jugendlichen selber wollen. In diesem Zusammenhang fordern wir die Bereitstellung von kommunalen und staatlichen Geldern für politische Arbeit und Freizeitgestaltung außerhalb der großen Verbände und Vereine. Die Förderung demokratischer Teilhabe muss sich von formeller Vereinsmeierei weg, hin zur Unterstützung freier Gruppen entwickeln.
IV. Leben und Leben lassen - Gegen Wohnklos und eine Leben in DIN-Fächern
Viele Jugendliche haben heute keine Lust mehr die Wohn- und Lebensmodelle ihrer Eltern zu übernehmen und in DIN-Wohnungen und Häusern ihr Leben zu beginnen und zu fristen. Sie wollen alleine oder auch zusammen mit anderen Jugendlichen oder auch Andersaltrigen in WGs, Wagenburgen, selbstrenovierten Räumen und ähnlichem Leben und hier ihrer Vorstellungen von Gemeinschaft oder auch Familie leben.
Nicht das nur wenig bezahlbarer Wohnraum in der Gesellschaft für Jugendliche bereitsteht, sondern auch für alternative Wohnmodelle, wie insbesondere Wagenburgen, fehlt die gesellschaftliche Akzeptanz und damit auch der Raum.
['solid] fordert die Kommunen auf mehr bezahlbaren Wohnraum zu Verfügung zu stellen und den kommunalen Wohnbau auch im Hinblick auf die Einrichtung alternativer Wohnprojekte zu fördern. Hierzu soll insbesondere auch geprüfte werden ob alter und sanierungsbedürftige kommunaler Gebäudebestand nicht Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden kann und von ihnen in Eigenregie bewohnt und saniert werden kann. Ferner sollen Wagenburgprojekte Unterstützung durch dei jeweiligen Gemeinden bekommen und als selbstgewählte Form des Wohnens gesellschaftlich akzeptiert werden und nicht als eine Verweigerungshaltung diskreditiert werden.
V. Jugendgerechte Infrastruktur
Angesichts knapper kommunaler Kassen wird immer mehr an kommunaler Infrastruktur zurückgebaut. Dies trifft insbesondere soziale und für Jugendliche relevante Projekte, wie bestimmte ÖPNV-Angebote, Schwimmbäder, Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze aber auch Bibliotheken, Theaterangebote usw.
All diese Angebote sind aber wichtig um Jugendlichen Möglichkeiten zu geben sich zu entwickeln und Erfahrungen zu sammeln. Hierbei ist nicht nur ihr Freizeitaspekt zu sehen, dessen Wert im Bezug auf die Bedeutung von Spiel und spielen für Jugendliche nicht zu unterschätzen ist, sondern auch ihre Eigenschaft als soziale Räume in denen Jugendliche unter sich sind, mit Problemen konfrotiert sind und selber Lösungsstrategien entwickeln oder in die sie sich einfach mal zurückziehen können.
Im weitern müssen auch die ebenefalls von Kürzungen betroffenen Jugendhilfeeinrichtungen, wie Beratungstellen aller Art, Sorgentelefone und Jugendhäuser erhalten und ausgebaut werden. Streetworker und Sozialarbeiter leisten wertvolle Arbeit und verhindern Gewalt und das Abrutschen in die Kriminalität, insbesondere in den am stärksten von den sozialen Härten dieser Gesellschaft Wohngegenden. Für wichtig halten wir in diesem Zusammenhang auch die stärkere Beschäftigung mit kulturellen Spannungen zwischen einzelnen Jugendgruppen und das Ergreifen wirksammer Maßnahmen gegen aufkommenden Rassismus und Gewalt unter ihnen durch die Einrichtung multikultureller Begegnunsstätten und die aktive Unterbreitung attraktiver Kommunikationsangebote.
['solid] fordert von den Kommunen den Druck auf die Landes- und Bundeseben zu erhöhen und jugenspezifische Infrastrukturen zu erhalten und zeitgleich auch in eigenen kommunalen Politikkonzepten einen deutlichen Schwerpunkte zu setzen.
„... Teil einer Jugendbewegung sein“
„Wir wollen die Köpfe und Herzen der Jugendlichen erobern“ heißt es in einem Gründungsaufruf von [’solid]: Wir wollen unser politisches Engagement nicht auf parlamentarische und theoretische Arbeit beschränken, sondern - im Gegenteil - alternative Jugendkultur leben und junge Menschen dafür begeistern! Das bedeutet für uns, dass wir nicht nur innerhalb unseres Verbandes einen kulturellen Anspruch erheben und somit (möglichst kostenlose) Politik mit Kultur verbinden möchten, sondern uns auch vor Ort für jugendpolitische Themen stark machen wollen.

Intro
Die Jugendzeit wird in dieser Gesellschaft immer weniger als wichtige Entwicklungsphase zur Herausbildung einer eigenständigen und selbstdenkenden Persönlichkeit gesehen - dementsprechend schlecht und kastriert zeigen sich auch die von der Gesellschaft der Erwachsenen gewährten Freiräume für Jugendliche sich zu entfalten.
Die Jugendzeit wird vielmehr als kurzer Duchlauferhitzer gesehen auf dem Weg zum Erwachsen werden und soll mit Lernen, der Vollziehung von Anpassungs- und Ausleseprozessen und ähnlichem verbracht werden, so dass ein möglichst reibungsloser Übergang in die Arbeitswelt gewährleistet wird. Eine solche Sicht reduziert den Menschen zur Ware bzw. zum Werkzeug der Produktionsprozesse und lässt für individuelle Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung kaum noch Raum.
In der alltäglichen Konsequenz bedeutet dies, dass Jugendliche daran gehindert werden die Welt frei zu entdecken, in ihr und an ihr zu lernen und überall auf Grenzen stoßen die sie zwanghaft in die Kategorien der Produktions- und Profitgesellschaft pressen wollen. Das Auslebung eines eigenen, oft alternativen Lebensentwurfes ist kaum möglich. Dahinter stehen auch überkommene Vorstellungen von Erziehung, die geringe Akzeptanz tatsächlicher jugendlicher Selbstständigkeit und letztendlich mangelndes Vertrauen.
In der Schule stehen so z.B. Konformität und Leistungsdruck mit dem Ziel der Auslese vor individueller Förderung, Stärkung der persönlichen Fähigkeiten und der bewussten Schaffung von Freiräumen die mit eigenen Ideen und Werten gefüllt werden können. Selbstverwaltete oder autonome Jugendzentren werden argwöhnisch beobachtet und oft finanziell unter Druck gesetzt oder ganz geschlossen, da sie außerhalb der Kontrolle der Erwachsenen-Gesellschaft existieren. Die "demokratischen" Mitbestimmungsmöglichkeiten für Jugendliche beschränken sich zum größten Teil auf Wählen ab dem 18. Lebensjahr oder teilweise auf die Bildung finanziell streng budgetierten Jugendgemeinderäten ohne wirkliche Mitentscheidungsrechte.
Diese Gesellschaft wird der Bedeutung und Wichtigkeit der Jugend für die Herausbildung aktiver, kritischer und frei denkender Individuen nicht gerecht - sie will es so wohl auch nicht!
I. Demokratie. Wählen. Jugendgemeinderat.
Aktives Wahlrecht ab 16!
Das aktive Wahlrecht ist ein Grundrecht und ein Mittel der Mit- und Selbstbestimmung. Nur wer wählen darf, kann heute aktiv teilhaben und seine Interessen aktiv vertreten! Heute erleben Jugendliche zu oft, dass über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen werden. Bisher sind Jugendliche von den Entscheidungen der Kommunalpolitik unmittelbar und direkt betroffen, ohne dass sie daran mitwirken können.
Aber junge Menschen wollen ernst genommen werden und Stück für Stück Verantwortung übernehmen. Sie sind nicht so unpolitisch wie sie allgemein beschrieben werden. Wissenschaftliche Untersuchungen beweisen zu dem, dass Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres politisch entscheidungsfähig sind und dem Abschluss der Pflichtschulzeit die Bereitschaft und die politische Kompetenz für die Teilnahme an Wahlen in Form der Wahrnehmung des aktiven Wahlrechts besitzen. Sie wollen sich verwirklichen, haben ganz konkrete Ziele und Wünsche.
Die Einführung des Jugendwahlrechts ab 16 wäre ein wichtiges Signal an die junge Generation. Jugendliche könnten so stärker in lebenswichtige politische Zukunftsentscheidungen integriert und ihre Meinung miteinbezogen werden. Sie würden sich ernst genommen fühlen und würden diesen Respekt an die Gesellschaft zurückgeben können und sie bereichern.
Parteien wären so gezwungen, sich stärker mit Themen aus einander zusetzen, die Jugendliche besonders bewegen; Themen wie Jugendarbeit, Kultur, Bildung, die Schaffung von Ausbildungsplätzen, Freizeit, Drogenpolitik oder die Armutsvermeidung und –bekämpfung, Umweltschutz und anderes mehr würden ein weitaus größeres Gewicht bekommen.
Die Absenkung des Wahlalters ist eine Chance, junge Leute frühzeitig an demokratische, parlamentarische Strukturen heranzuführen und damit Demokratie erleb- und erlernbar zu machen. Auch die Schule ist in diesem Zusammenhang verpflichtet, uns Jugendliche an die politische Öffentlichkeit heranzuführen. Geschichtliche Grundlagen, politische Aktualität müssen Jugendlichen erklärt werden, um politisches Interesse für ihr Umfeld zu wecken. Die Menschen heute treten viel früher ins Jugendalter ein und verlassen es später. Durch mangelnde Arbeitsplätze verlängert sich die Schul- und Ausbildungszeit.
Es herrscht eine deutliche Diskrepanz von sozialer und juristischer Reife. Dieser Entwicklung wird erst durch die Einführung des Jugendwahlrechts Rechnung getragen. Denn wir sind diejenigen, die künftig mit den heute getroffenen Entscheidungen leben müssen. Eine Änderung des Wahlrechts sollte mit einer Informationspflicht der Altersgruppe einhergehen.
Langfristig kann sich daran die Überlegung anschließen, das Wahlalter schrittweise auch auf 14 zu senken. Dies muss allerdings mit einer entsprechenden Würdigung von gesellschaftspolitischen Themen in der Schule und der Gesamtgesellschaft einhergehen. Erst wenn Jugendliche schon früh für solche Themen sensibilisiert sind und die Folgen ihrer politischen Entscheidungen abschätzen können.
Jugendgemeinderäte
Die Schaffung von gut-ausgestatteten Jugendgemeinderäten mit wirklichen Mitbestimmungsrechten ist ein weiterer Schritt zu einer Demokratisierung der Gesellschaft und der Jugendstrukturen. Dadurch würden Jugendliche nicht nur frühzeitig den Dialog miteinander suchen und ihre Wünsche und Ideen besser in der kommunalen Alltagspolitik besser vertreten sehen, die Einbeziehung von Jugendlichen in den politischen Prozess würde auch zu einer positiven Verbreiterung der kommunalen Agenda führen.
Bei den derzeit existierenden Jugendgemeinderäten in Baden-Württemberg besteht zumeist jedoch das Problem, dass sie über keine wirklichen Mitbestimmungsmöglichkeiten verfügen und ihr Budget stark begrenzt ist. In der Öffentlichkeit werden sie deshalb kaum wahrgenommen, die Wahlbeteiligung liegt zumeist unter 25% und ihre Arbeit beschränkt sich in manchen Städten nur auf die Organisation von Partys und Jugendfesten. Um diesem Problem zu entgegnen, müssen die Jugendgemeinderäte mit wirklichen Entscheidungsmöglichkeiten ausgestattet und mit in die Verantwortung gezogen werden, um die Jugendlichen stärker zu politisieren und für politische Probleme zu sensibilisieren.
Wir fordern auf der anderen Seite die Jugendgemeinderäte auf, ihre organisatorischen Strukturen zu überprüfen und ihre Arbeit transparenter machen. Sie dürfen nicht als Kindergartenparlamente fungieren, sondern müssen eigenständig eine kritisch-integrative Arbeit betreiben.
II. Bildung ist Zukunft!
Schule oder Schule?
Schule hat heutzutage für junge Menschen keinen emanzipatorischen Anspruch! Jugendliche können sich derzeit in der Schule nicht selbst verwirklichen und werden auch nicht in ihren persönlichen Stärken gefördert. Vielmehr bedeutet Schule für die SchülerInnen zumeist Auswendiglernen, vollgestopfte Stunden- und Lehrpläne, harte Selektionsprozesse und nicht selten unmotivierte Lehrer.
Durch die Oberstufenreform der Landesregierung wurde diese Situation noch verschärft: Lehrer und Schüler sind vollkommen überfordert, an vielen Schule betreiben die Lehrer nur noch „Dienst nach Vorschrift“, Klassenfahrten und Projekttage sind gestrichen, die Anzahl der „gefährdeten“ Schülerinnen und Schülern ist seit Einsetzen der Reform in die Höhe geschnellt. Durch den Wegfall der meisten Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe haben die Jugendlichen kaum noch Möglichkeiten, ihren Lehrplan nach ihren Vorstellungen zusammenzustellen, sondern müssen sich auch hier der Verwertungslogik unterwerfen. Die anschließende Motivation tendiert gegen Null.
Wir wollen eine Schule, deren Augenmerk sich auf die menschlichen Bedürfnisse der SchülerInnen und auch der LehrerInnen richtet! Dazu bedarf es aber einer Abschaffung des Frontal- und Paukunterrichts und ein Ende des selektiven Leistungsprinzips. Stattdessen müssen die Fähigkeiten der Schüler individuell und kritisch begleitet und gefördert werden, um Fehler zu verbessern und Schwächen durch deren Anerkennung zu beseitigen. Statt gefördertem Konkurrenzdenken und der frühzeitigen Auslese muss die natürliche Neugier der Kinder gefördert und erhalten werden, damit Schule wieder Spaß macht!
Dazu muss die integrierte Gesamtschule zur Regelschule und die Klassen wieder kleiner werden - denn unsere Schulen stellen einen wichtigen Ort in der Prägung von Persönlichkeit und Charakter dar. Auch deswegen gehören soziale Ausgrenzungen und Ungerechtigkeiten nicht in die Schulen. Schule muss zu einem sozialem Lebensraum werden! Dazu gehören gelebte Solidarität, Kultur, Politik, Integration und Spaß - erreichbar u.a. durch Ganztagsschulen mit Spielezimmern, Sportanlagen, unzensierten Schülerzeitungen, vielseitigen Projekten & Ags, Mensen, etc. All diese Dinge fehlen im heutigen Schulsystem und führen zu überforderten Lehrern, dem Konsum von Aufputschmitteln, um dem Leistungsdruck standzuhalten und zu Ausbrüchen von Gewalt. Eindeutige Indizien dafür sind u.a. auch der kontinuierliche Anstieg bei Nachhilfestunden und die steigende Zahl an Schülern und Lehrern die sozial-psychologische Betreuung in Anspruch nehmen.
Schule aus – Ausbildung macht Schule!
Die Einschränkung der Arbeitnehmerrechte und der Stellenabbau vor allem bei größeren Unternehmen in Zeiten einer neoliberalen Globalisierung bleibt auch für Jugendliche nicht ohne Folgen: immer mehr junge Menschen finden nach der Schule keinen Ausbildungsplatz und sind arbeitslos. In den letzten Jahren hat sich diese Situation durch die Wirtschaftskrise weiter verschärft. Um langfristig genügend Arbeitsplätze zu sichern und einen drohenden Fachkräftemangel zu vermeiden, ist es notwendig, die Kosten der Ausbildung gerechter zu verteilen. Eine gesetzliche Regelung könnte hierbei Ausbildungsplätze erhalten, sowie das Angebot an betrieblichen Ausbildungsstellen erhöhen.
Deshalb fordern wir, die sozialistische Jugend ['solid] in Baden-Württemberg eine solidarische Ausbildungsumlagefinanzierung! Hierfür würden alle Unternehmen, Betriebe und Verwaltungen Abgaben in einen Ausbildungsfond zahlen, wobei für die Höhe der Abgabe Kriterien wie die Zahl der Beschäftigten, Lohnsumme und die Wertschöpfung des Unternehmens ausschlaggebend ist. Betriebe, die anschließend Ausbildungsplätze stellen, erhalten wiederum eine ausgleichende Unterstützung aus dem Ausbildungsfond für die Beibehaltung und weitere Entstehung von Ausbildungsplätzen. Dadurch könnten nun auch Betriebe, die es sich bisher nicht leisten konnten auszubilden, durch ihren Anspruch auf einen Anteil am Fond Ausbildungsplätze schaffen.
Um diese Forderung durchzusetzen oder für die Erhaltung und Erweiterung der Arbeitnehmerrechte erfolgreich zu kämpfen, muss die Position der Gewerkschaften – auch von Jugendlichen - gestärkt werden. Ein Engagement in einer Gewerkschaft ist sicherlich kein sinnloses unterfangen, sondern notwendig, um soziale Gerechtigkeit zu erstreiten.
III. Unser Leben gehört nicht den Konzernen - Freiräume schaffen und verteidigen!
In vielen Städten, aber noch viel stärker auf dem Land fehlt es an Möglichkeiten für unabhängige und außerhalb von Verbänden organisierte Jugendkultur, in welcher Jugendliche sich frei nach ihren Interessen entfalten und entwickeln können. Selbstverwaltete Jugendzentren werden zumeist finanziell und bürokratisch unter Druck gesetzt oder – wie in Heidelberg - gleich abgerissen. Auch städtische Jugendarbeit findet, wenn überhaupt, nur in begrenztem Rahmen und wenig effizient statt. Es mangelt fast überall an Personal und den entsprechenden Räumlichkeiten, um ein Zentrum für eine große, integrative Jugend- und auch Gegenkultur zu schaffen. Verbunden mit Perspektivlosigkeit zeigen sich die Folgen von diesen Versäumnissen vor allem in dem weiteren Wachsen rechter und rechtsextremistischer Strukturen, bzw. der informellen Rechtslastigkeit und rassistischen Ressentiments bei Jugendlichen zumeist auf dem Land.
Auf der anderen Seite werden viele Organisationen der Berufsjugendlichen finanziell stark gefördert und vorhanden Mittel erreichen so nur einen Teil der Jugendlichen. Jugendkultur außerhalb von Vereinen hat kaum eine Möglichkeit in den Genuss kommunaler und staatlicher Gelder zu kommen. So ist z.B. der so genannte Ring Politischer Jugend im Grunde eine Finanzgremium der Jugendverbände der Großen Parteien. Viele politische Jugendliche wie örtliche Gruppen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, Antifas, Subkultur-Vereine sind von diesen Mitteln ausgeschlossen, obwohl sie wertvolle und Eigenverantwortung stärkende politische Arbeit leisten. Selbiges gilt auch für Sportinteressierte außerhalb der Vereine und Sportverbände, wie Inline-Skater, Biker, Skater und BmXer, die sich ihre Sportplätze meist illegal erobern müssen und früher oder später wieder verjagt werden.
['solid] setzt sich ein für Freiräume und Räume für selbstorganisierte und freie Jugendarbeit fern von der Trägerschaft durch Kirchen und Verbände. Wir setzen uns ein für Möglichkeiten selbst Erfahrungen zu sammeln und Kultur und Zusammenleben so zu gestalten wie es die Jugendlichen selber wollen. In diesem Zusammenhang fordern wir die Bereitstellung von kommunalen und staatlichen Geldern für politische Arbeit und Freizeitgestaltung außerhalb der großen Verbände und Vereine. Die Förderung demokratischer Teilhabe muss sich von formeller Vereinsmeierei weg, hin zur Unterstützung freier Gruppen entwickeln.
IV. Leben und Leben lassen - Gegen Wohnklos und eine Leben in DIN-Fächern
Viele Jugendliche haben heute keine Lust mehr die Wohn- und Lebensmodelle ihrer Eltern zu übernehmen und in DIN-Wohnungen und Häusern ihr Leben zu beginnen und zu fristen. Sie wollen alleine oder auch zusammen mit anderen Jugendlichen oder auch Andersaltrigen in WGs, Wagenburgen, selbstrenovierten Räumen und ähnlichem Leben und hier ihrer Vorstellungen von Gemeinschaft oder auch Familie leben.
Nicht das nur wenig bezahlbarer Wohnraum in der Gesellschaft für Jugendliche bereitsteht, sondern auch für alternative Wohnmodelle, wie insbesondere Wagenburgen, fehlt die gesellschaftliche Akzeptanz und damit auch der Raum.
['solid] fordert die Kommunen auf mehr bezahlbaren Wohnraum zu Verfügung zu stellen und den kommunalen Wohnbau auch im Hinblick auf die Einrichtung alternativer Wohnprojekte zu fördern. Hierzu soll insbesondere auch geprüfte werden ob alter und sanierungsbedürftige kommunaler Gebäudebestand nicht Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden kann und von ihnen in Eigenregie bewohnt und saniert werden kann. Ferner sollen Wagenburgprojekte Unterstützung durch dei jeweiligen Gemeinden bekommen und als selbstgewählte Form des Wohnens gesellschaftlich akzeptiert werden und nicht als eine Verweigerungshaltung diskreditiert werden.
V. Jugendgerechte Infrastruktur
Angesichts knapper kommunaler Kassen wird immer mehr an kommunaler Infrastruktur zurückgebaut. Dies trifft insbesondere soziale und für Jugendliche relevante Projekte, wie bestimmte ÖPNV-Angebote, Schwimmbäder, Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze aber auch Bibliotheken, Theaterangebote usw.
All diese Angebote sind aber wichtig um Jugendlichen Möglichkeiten zu geben sich zu entwickeln und Erfahrungen zu sammeln. Hierbei ist nicht nur ihr Freizeitaspekt zu sehen, dessen Wert im Bezug auf die Bedeutung von Spiel und spielen für Jugendliche nicht zu unterschätzen ist, sondern auch ihre Eigenschaft als soziale Räume in denen Jugendliche unter sich sind, mit Problemen konfrotiert sind und selber Lösungsstrategien entwickeln oder in die sie sich einfach mal zurückziehen können.
Im weitern müssen auch die ebenefalls von Kürzungen betroffenen Jugendhilfeeinrichtungen, wie Beratungstellen aller Art, Sorgentelefone und Jugendhäuser erhalten und ausgebaut werden. Streetworker und Sozialarbeiter leisten wertvolle Arbeit und verhindern Gewalt und das Abrutschen in die Kriminalität, insbesondere in den am stärksten von den sozialen Härten dieser Gesellschaft Wohngegenden. Für wichtig halten wir in diesem Zusammenhang auch die stärkere Beschäftigung mit kulturellen Spannungen zwischen einzelnen Jugendgruppen und das Ergreifen wirksammer Maßnahmen gegen aufkommenden Rassismus und Gewalt unter ihnen durch die Einrichtung multikultureller Begegnunsstätten und die aktive Unterbreitung attraktiver Kommunikationsangebote.
['solid] fordert von den Kommunen den Druck auf die Landes- und Bundeseben zu erhöhen und jugenspezifische Infrastrukturen zu erhalten und zeitgleich auch in eigenen kommunalen Politikkonzepten einen deutlichen Schwerpunkte zu setzen.
„... Teil einer Jugendbewegung sein“
„Wir wollen die Köpfe und Herzen der Jugendlichen erobern“ heißt es in einem Gründungsaufruf von [’solid]: Wir wollen unser politisches Engagement nicht auf parlamentarische und theoretische Arbeit beschränken, sondern - im Gegenteil - alternative Jugendkultur leben und junge Menschen dafür begeistern! Das bedeutet für uns, dass wir nicht nur innerhalb unseres Verbandes einen kulturellen Anspruch erheben und somit (möglichst kostenlose) Politik mit Kultur verbinden möchten, sondern uns auch vor Ort für jugendpolitische Themen stark machen wollen.