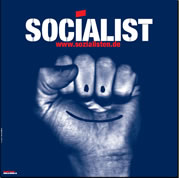Von Christoph Rehm, Landessprecher der sozialistischen Jugend ['solid] - Baden-Württemberg in "Die WARE.".
Was das Scheitern des WTO-Gipfels für die globalisierungskritische Bewegung bedeutet und wie der zukünftige Protest aussehen muss.
Jubel, Trubel, Heiterkeit – der WTO-Gipfel in Cancun ist gescheitert und Globalisierungskritiker aus aller Welt versinken in einem Meer aus Freude und Genugtuung. Zu groß war dieses Mal die Distanz zwischen den Forderungen der Entwicklungsländer und dem profitablen Wunschdenken der Industriestaaten. Zu groß war der Protest der und die Geschlossenheit der Ärmsten dieser Welt gegen die ausbeuterische Politik der Reichen. Und zu groß war zum ersten Mal auch die Kritik und der Druck selbst der bürgerlichen Medien und Finanzexperten gegen die Politik der nördlichen Länder („Der Gipfel der Heuchelei“, Spiegel 37/03). Was bleibt ist die Hoffnung, dass die Entwicklungsländer und Globalisierungskritiker gestärkt aus dem WTO-Gipfel hinausgehen und der öffentliche Druck gegen den Handelskrieg der Industriestaaten weiter wachsen wird. Denn von alleine werden sie diesen nicht beenden. Vielmehr werden sie versuchen – wie schon bei der Gründung der WTO und den Verhandlungen zu den Subventionskürzungen 1995 – mit allen möglichen Tricks und Täuschungen, die Entwicklungsländer aus- und ihrer Wirtschaft unfaire Exportvorteile zuzuspielen. Doch wie muss der Protest dagegen aussehen und was sind die konkreten Forderungen, die es von unsrer Seite aus durchzusetzen gilt?
Blaisé Compaoré, Präsident des afrikanischen Staates Burkina Faso fordert z.B. „nur, dass die Regeln des freien Marktes angewandt werden“ und spielt damit vor allem auf die euro-amerikanischen Agrarsubventionen an, durch welche die Bauern aus den Entwicklungsstaaten monatlich mehrere Millionen Dollar verlieren. Und auch deutsche Finanzexperten sind der Meinung, dass man nicht auf der einen Seite von den Entwicklungsländern eine Liberalisierung der Märkte verlangen könne, wenn man gleichzeitig mit Milliardensubventionen „eine staatliche Planwirtschaft“ betreibe. Doch stellen Liberalisierung und Subventionsabbau wirklich eine Lösung des Problems dar? Können offene Märkte ein wirksames Mittel im weltweiten Kampf gegen Armut sein? Wohl kaum! Zwar ist ein Subventionsabbau von europäischer und amerikanischer Seite in Bezug auf Agrar- und Baumwollprodukte mehr als überfällig, Liberalisierungswellen in Entwicklungsländern sind im Kampf gegen Armut jedoch wenig hilfreich. Vielmehr fördern Marktöffnung und Privatisierung ein weiteres Wachsen der Kluft zwischen Arm und Reich, den Niedergang der einheimischen Wirtschaft und die finanzielle Ausbeutung des Landes durch westliche Unternehmen.
In Indien findet man ein typisches Beispiel dafür, wie Privatisierung und Liberalisierung genau das Gegenteil davon bewirkt haben, was uns selbsternannte Wirtschaftsexperten als „Kampf gegen Armut und Hunger“ verkaufen wollen: Im Land der Arier, Parias und heiligen Kühe hat man sich mit der Weltmarktöffnung zwar lang, bis zur Regierung Rao 1991, zurückgehalten und konnte deshalb stärker als andere, sogenannte „3.Welt-Staaten“ dem Einfluss der Industriestaaten entgegentreten. Die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen hat dort den Dualismus des Landes und das Wachsen der Armut jedoch weiter verschärft. Nach der Entstaatlichung der Wasserwirtschaft besitzt heute auf der einen Seite nahezu jeder Inder einen eigenen Wasseranschluss. Auf der anderen Seite sind die Wasserpreise durch die Privatisierung jedoch so stark in die Höhe gestiegen, dass sich jedoch vor allem arme Familien – und diese stellen in Indien die Mehrheit - ein Aufdrehen des Wasserhahnes kaum noch Leistungen können und deshalb weiterhin ihr Wasser über Marke Regentonne inklusive Bakterieninfektion beziehen (wenn überhaupt!).
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik sind eng miteinander verknüpft. Nicht nur deshalb ist die Etablierung eines weltweiten, fairen Handels für vernünftige Entwicklungspolitik essentiell. Neben dem Ende der Agrarsubventionen auf europäischer und amerikanischer Seite gilt es, Entwicklungsstaaten spezielle Sonderrechte wie Schutzzölle, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft oder billige Patenmedikamente zuzugestehen, anstatt sie weiterhin dem wirtschaftlichen Liberalisierungsdruck auszusetzen. Nur so kann eine globale Entwicklungs- und Anti-Terror-Politik betrieben werden. Doch von solchen Zugeständnissen sind die reichsten Staaten der Welt, die zwar nur 20% der Bevölkerung aber 80% des weltweiten Warenaustausches stellen, soweit entfernt wie die SPD von der Sozialdemokratie. Der Protest muss und wird also weitergehen. In diesem Sinne:
Bis zum nächsten Gipfel!
Was das Scheitern des WTO-Gipfels für die globalisierungskritische Bewegung bedeutet und wie der zukünftige Protest aussehen muss.
Jubel, Trubel, Heiterkeit – der WTO-Gipfel in Cancun ist gescheitert und Globalisierungskritiker aus aller Welt versinken in einem Meer aus Freude und Genugtuung. Zu groß war dieses Mal die Distanz zwischen den Forderungen der Entwicklungsländer und dem profitablen Wunschdenken der Industriestaaten. Zu groß war der Protest der und die Geschlossenheit der Ärmsten dieser Welt gegen die ausbeuterische Politik der Reichen. Und zu groß war zum ersten Mal auch die Kritik und der Druck selbst der bürgerlichen Medien und Finanzexperten gegen die Politik der nördlichen Länder („Der Gipfel der Heuchelei“, Spiegel 37/03). Was bleibt ist die Hoffnung, dass die Entwicklungsländer und Globalisierungskritiker gestärkt aus dem WTO-Gipfel hinausgehen und der öffentliche Druck gegen den Handelskrieg der Industriestaaten weiter wachsen wird. Denn von alleine werden sie diesen nicht beenden. Vielmehr werden sie versuchen – wie schon bei der Gründung der WTO und den Verhandlungen zu den Subventionskürzungen 1995 – mit allen möglichen Tricks und Täuschungen, die Entwicklungsländer aus- und ihrer Wirtschaft unfaire Exportvorteile zuzuspielen. Doch wie muss der Protest dagegen aussehen und was sind die konkreten Forderungen, die es von unsrer Seite aus durchzusetzen gilt?
Blaisé Compaoré, Präsident des afrikanischen Staates Burkina Faso fordert z.B. „nur, dass die Regeln des freien Marktes angewandt werden“ und spielt damit vor allem auf die euro-amerikanischen Agrarsubventionen an, durch welche die Bauern aus den Entwicklungsstaaten monatlich mehrere Millionen Dollar verlieren. Und auch deutsche Finanzexperten sind der Meinung, dass man nicht auf der einen Seite von den Entwicklungsländern eine Liberalisierung der Märkte verlangen könne, wenn man gleichzeitig mit Milliardensubventionen „eine staatliche Planwirtschaft“ betreibe. Doch stellen Liberalisierung und Subventionsabbau wirklich eine Lösung des Problems dar? Können offene Märkte ein wirksames Mittel im weltweiten Kampf gegen Armut sein? Wohl kaum! Zwar ist ein Subventionsabbau von europäischer und amerikanischer Seite in Bezug auf Agrar- und Baumwollprodukte mehr als überfällig, Liberalisierungswellen in Entwicklungsländern sind im Kampf gegen Armut jedoch wenig hilfreich. Vielmehr fördern Marktöffnung und Privatisierung ein weiteres Wachsen der Kluft zwischen Arm und Reich, den Niedergang der einheimischen Wirtschaft und die finanzielle Ausbeutung des Landes durch westliche Unternehmen.
In Indien findet man ein typisches Beispiel dafür, wie Privatisierung und Liberalisierung genau das Gegenteil davon bewirkt haben, was uns selbsternannte Wirtschaftsexperten als „Kampf gegen Armut und Hunger“ verkaufen wollen: Im Land der Arier, Parias und heiligen Kühe hat man sich mit der Weltmarktöffnung zwar lang, bis zur Regierung Rao 1991, zurückgehalten und konnte deshalb stärker als andere, sogenannte „3.Welt-Staaten“ dem Einfluss der Industriestaaten entgegentreten. Die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen hat dort den Dualismus des Landes und das Wachsen der Armut jedoch weiter verschärft. Nach der Entstaatlichung der Wasserwirtschaft besitzt heute auf der einen Seite nahezu jeder Inder einen eigenen Wasseranschluss. Auf der anderen Seite sind die Wasserpreise durch die Privatisierung jedoch so stark in die Höhe gestiegen, dass sich jedoch vor allem arme Familien – und diese stellen in Indien die Mehrheit - ein Aufdrehen des Wasserhahnes kaum noch Leistungen können und deshalb weiterhin ihr Wasser über Marke Regentonne inklusive Bakterieninfektion beziehen (wenn überhaupt!).
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik sind eng miteinander verknüpft. Nicht nur deshalb ist die Etablierung eines weltweiten, fairen Handels für vernünftige Entwicklungspolitik essentiell. Neben dem Ende der Agrarsubventionen auf europäischer und amerikanischer Seite gilt es, Entwicklungsstaaten spezielle Sonderrechte wie Schutzzölle, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft oder billige Patenmedikamente zuzugestehen, anstatt sie weiterhin dem wirtschaftlichen Liberalisierungsdruck auszusetzen. Nur so kann eine globale Entwicklungs- und Anti-Terror-Politik betrieben werden. Doch von solchen Zugeständnissen sind die reichsten Staaten der Welt, die zwar nur 20% der Bevölkerung aber 80% des weltweiten Warenaustausches stellen, soweit entfernt wie die SPD von der Sozialdemokratie. Der Protest muss und wird also weitergehen. In diesem Sinne:
Bis zum nächsten Gipfel!